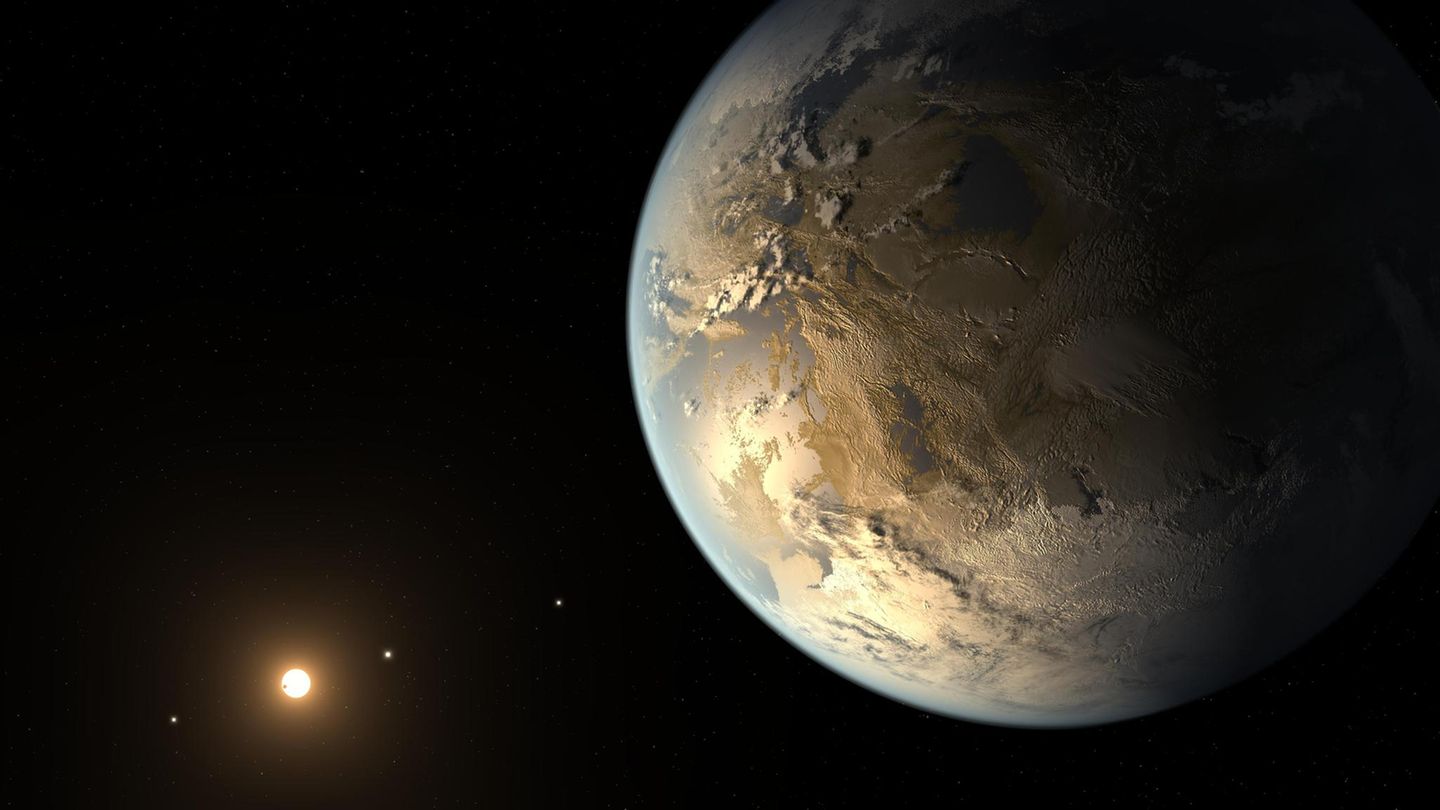Zivilisationen wie unsere dürften in der Milchstraße ziemlich selten sein. Die nächste von ihnen liegt wohl 33.000 Lichtjahre entfernt, so neue Kalkulationen
Gibt es außer uns noch Leben im All? Diese Frage beschäftigt die menschliche Fantasie schon lange. Und seit einigen Jahrzehnten auch die Wissenschaft. So fahnden Forschende etwa mit riesigen Parabolantennen nach Signalen außerirdischer Intelligenzen – bislang jedoch ohne Erfolg. Nun halten viele Forschende es zwar für sehr wahrscheinlich, dass nicht nur irgendwo im All, sondern auch in unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße, Leben möglich ist und existiert. Völlig unklar ist bislang aber, mit wie vielen technisch hoch entwickelten Zivilisationen wir rechnen können. (Die zumindest in der Lage wären, mit uns Menschen Kontakt aufzunehmen.)
Die Antwort zweier österreichischer Astronomen: Ziemlich wenige.
Ihre etwas ernüchternde Berechnung haben Dr. Manuel Scherf und Prof. Helmut Lammer vom Institut für Weltraumforschung in Graz nun beim diesjährigen Europlanet Science Congress in Helsinki vorgestellt. Demnach befindet sich die nächstgelegene Zivilisation möglicherweise 33.000 Lichtjahre entfernt von uns – also, von der Erde aus gesehen, auf der anderen Seite der Milchstraße. Und sie müsste mindestens 280.000, vielleicht auch eine Million Jahre alt sein, um zur gleichen Zeit zu existieren wie unsere Zivilisation.
Der Grund dafür liegt laut den Autoren in den besonderen Bedingungen, die gegeben sein müssen, damit Leben entstehen kann und Zivilisationen sich entwickeln können.
Entscheidend ist zunächst der richtige Abstand zum Zentralgestirn und eine Atmosphäre mit einem günstigen Kohlenstoffdioxid-Anteil: Je höher die Konzentration, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Anziehungskraft des Planeten ausreicht, um die Atmosphäre am Entweichen ins All zu hindern – und um pflanzliche Photosynthese zu ermöglichen. Ein Zuviel jedoch würde zu einem Treibhauseffekt führen. Und wäre für höher entwickelte Organismen toxisch.
Ohne Plattentektonik kein Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre
Aus genau diesem Grund ist laut den Autoren die Plattentektonik eines Planeten entscheidend: Vulkane schleudern dort, wo Platten aufeinanderprallen oder auseinandergerissen werden, große Mengen Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre. Allerdings nicht für immer. Denn sobald die Plattenbewegungen zum Erliegen kommen – für die Erde wird in 200 Millionen bis einer Milliarde Jahren damit gerechnet – wird der Kohlenstoff komplett in Gesteinen eingelagert sein. Photosynthese ist dann nicht mehr möglich.
Die beiden Autoren haben nun für verschiedene Kohlenstoffdioxid-Konzentrationen in der Atmosphäre durchgerechnet, wie lange Leben auf einem Planeten möglich wäre. Demnach könnte ein erdähnlicher Planet mit einer CO2-Konzentration von zehn Prozent seine Biosphäre immerhin 4,2 Milliarden Jahre lang erhalten. Bei einer Konzentration von nur einem Prozent wären es dagegen nur maximal 3,1 Milliarden Jahre.
Aber auch Sauerstoff muss natürlich in ausreichender Menge vorhanden sein: mindestens 18 Prozent veranschlagen die Autoren. Denn zum einen wäre die Entwicklung höheren Lebens mit weniger O2 unmöglich. Zum anderen wäre offenes Feuer undenkbar – ohne das es die menschliche Zivilisation nicht gäbe.
All diese Faktoren zusammengenommen, kommen die Autoren zu dem Ergebnis: „Damit zehn Zivilisationen [in der Milchstraße, d. Red.] gleichzeitig mit unserer existieren können, muss die durchschnittliche Lebensdauer über zehn Millionen Jahre betragen“, sagt Scherf laut einer Pressemitteilung. Die Anzahl der Extraterrestrischen Intelligenzen (ETI) sei damit „ziemlich gering“. Sie hänge zum großen Teil von der Lebensdauer einer Zivilisation ab, sagt Scherf.
Sollten wir die Suche nach außerirdischer Intelligenz also einstellen? Keineswegs, meint Scherf. „Auch wenn ETIs selten sein mögen, gibt es nur einen Weg, herauszufinden, ob es sie gibt, nämlich indem man nach ihnen sucht.“